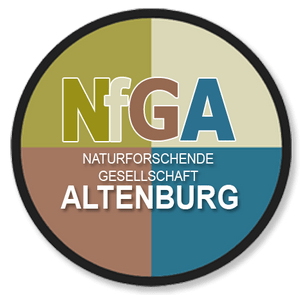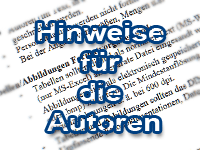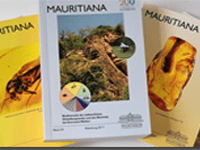Aufmerksame Wanderer werden in den vergangenen Wochen das emsige Treiben auf der sog. Lehrgrenze aber auch auf anderen Heideflächen im Pöllwitzer Wald bemerkt haben. Im Auftrag des von Freistaat Thüringen und Europäischer Union geförderten Projektes zur Entwicklung von Natur und Landschaft „Zwergstrauchheiden Pöllwitzer Wald“ des Altenburger Naturkundemuseums Mauritianum wurden dringend notwendige Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen umgesetzt.
Zwergstrauchheiden – das sind die überwiegend von Heidekraut aber auch von Heidel- und Preiselbeeren bewachsenen, trockenen Offenlandbereiche inmitten des Pöllwitzer Waldes. Sie entwickelten sich einst vor allem auf den militärisch genutzten Bereichen der sog. Lehrgrenze, des Schießplatzes, des Taktik-Geländes und des Sprengmittelplatzes. Bis etwa 1990 wurden sie durch Militärfahrzeuge aber auch durch kleinere Brände „gepflegt“ und so auch verjüngt. Danach versuchten ehrenamtliche Naturschützer und die Untere Naturschutzbehörde den auch nach EU-Recht geschützten Lebensraum mit seinen seltenen, licht- und wärmeliebenden Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Doch trotz aller Mühen verschlechterte sich der Zustand der Zwergstrauchheiden dramatisch. 1997 existierten etwa 35 ha Heide, 2013 nur noch 21 ha. In den darauf folgenden Jahren verringerte sich der Bestand immer mehr. Im Spätsommer 2016 konnten lediglich 9,6 ha Zwergstrauchheide erfasst werden. Viele der zuvor als Heide charakterisierten Flächen waren nur noch als Entwicklungsflächen einzustufen. Und das obwohl in ihnen die typischen Pflanzenarten vorkamen. Schuld waren vielmehr die üppig aufgewachsenen Birken, die die Heide zu stark beschatteten.
In Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit dem Flächeneigentümer, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und ihrer gemeinnützigen Tochtergesellschaft DBU Naturerbe GmbH, dem Bundesforstbetrieb und der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) konnte nun im Rahmen des oben genannten Projektes der Birkenjungwuchs durch ortsnah ansässige Firmen beseitigt werden. Allein durch diese Freischneidearbeiten erhöhte sich der Bestand an Zwergstrauchheide wieder auf fast 14 ha. Zusätzlich wurden auf einer etwa 2,4 ha großen Testfläche im Bereich der Lehrgrenze neben dem Birkenaufwuchs auch die Moos- und Grasschicht entfernt. Der dichte Wurzelfilz verhinderte bisher das Auskeimen der winzigen, aber über Jahrzehnte lebensfähigen Samen des Heidekrauts. Momentan erinnert diese Fläche eher an einen gut vorbereiteten Acker. Aber hier bietet sich der Zwergstrauchheide nun endlich wieder die Chance zur Verjüngung. Auch wenn in diesem Spätsommer nicht überall ein lila Blütenmeer bewundert werden kann, steigt für den Besucher dennoch der Erholungs- und Erlebniswert des Gebietes. Das menschliche Auge liebt die Abwechslung. Und diese ist auf den sich neu entwickelnden Flächen garantiert.
Um die erneute Verbuschung der Flächen langfristig zu verhindern, wird die Lehrgrenze noch in diesem Jahr durch Ziegen, Schafe und möglicherweise auch zwei Esel beweidet. Schafe sind vielen aus der Lüneburger Heide bereits als Heidepfleger bekannt. Ziegen mögen die frischen Blätter neu aufwachsender Bäume und Sträucher. Esel wiederum fressen gern Gräser, welche Ziegen und Schafe verschmähen. Außerdem schaffen sie durch Suhlen kleinflächig Bereiche ohne Pflanzenwuchs. Hier legen wärmeliebende Insekten ihre Eier ab. Und auch das Heidekraut kann dort keimen. Die Weidetiere helfen also beim Erhalt der Heide. Für sie wird ab Ende April ein Weidezaun errichtet. Dann können Spaziergänger die tierischen Landschaftspfleger bei der Arbeit beobachten.
Im vergangenen Sommer beschatteten unzählige junge Birken die Zwergstrauchheiden.
Auf solchen Freiflächen fühlt sich auch die in ihrem Bestand gefährdete Heidelerche wohl.
Hier wurden Bedingungen geschaffen, in dem junges Heidekraut aufwachsen kann.
Esel sind bald auch im Pöllwitzer Wald als Landschaftspfleger im Einsatz.
Text und Fotos: Dr. Elisabeth Endtmann
Naturkundemuseum Mauritianum Altenburg, Parkstr. 1, 04600 Altenburg